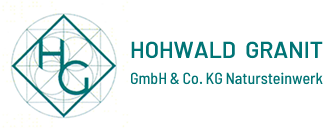Das Wappen der deutschen Steinmetze
Die Steinmetzzunft entstand aus den frühmittelalterlichen Klosterbauhütten heraus.
Diese scholastischen Einflüsse wirkten bis in die Zeit der hochmittelalterlichen Zünfte, welche dem Geiste der Zeit nach hinter die greifbaren Dinge des Alltags und die bloß vorstellbaren Dinge des geistigen Lebens schauen und sah gar bald in Ihnen mehr , als ihr bloßes augenfälliges Sinnbild. Sie wurden wirkliche Sinnbilder für dahinter stehende Begriffe. Aus diesem Hintergrund heraus sind die Darstellungen auf dem Steinmetzwappen zu verstehen.
Der Steinmetzberuf war seit jeher ein besonderer.
Den harten Stein zu bearbeiten, ihn zu formen und Werke für die Ewigkeit zu hinterlassen, muss jeden, der diese Kunst gelernt hat, mit Freude und Stolz erfüllt haben – aber auch mit Demut und Gottesfürchtigkeit, denn die Arbeit war mühselig und gefährlich.
Im Jahre 1515 wurde den deutschen Steinmetzen von Kaiser Maximilian den Ersten als Ehrenmal ihr Wappen verliehen. Dieser Kaiser war dem Steinmetzstand besonders zugeneigt, denn er hatte das Handwerk wahrscheinlich selbst erlernt, sodass er darin eine Prüfung abgelegt hat, wie uns Franz Burgmair in seinem Buch „Weisskunig“ bestätigt.
Der Entwurf für das Wappen wurde nach mündlichen Überlieferungen von Albrecht Dürer nach Angaben fachkundiger Hüttenmeister umgesetzt.

Bedeutung der Symbole
Auf dem Wappen sind mehrere Symbolde dargestellt:
Die Krone
Die Bauhütten standen außer unter kirchlichen Schutz und der unmittelbaren Schutzherrschaft von Kaiser und Reich auch unter dem Schutz von bestimmten Heiligen. Oberste Schutzheilige war die heilige Mutter Gottes mit dem Kinde, deren Feste stets mit allem Hüttenprunk begangen wurden. Die Krone ist ihr Sinnbild.
Der Adler mit einer Feder im Schnabel
Er ist Sinnbild für Johannes den Evangelisten und Apostel, dessen Gedenktag der 27. Dezember ist. Er war der Sohn des Zebedäus und der Bruder des Jakobus und starb um das Jahr 100 als Bischof von Ephesus. Johannes war der jüngste unter den zwölf Aposteln und der Lieblingsjünger des Herrn. Er war geistig dem Herrn so nahe und erhob sich mit seinen Erkenntnissen über alle anderen Jünger, dass für ihn als Symbol der Adler gewählt wurde. Die Feder deutet auf die Tätigkeit des Schreibens hin.
Helm und Schild
Seit dem 14.Jahrhundert durften Meister ihre Zeichen (genannt Handgemal) ins Schild setzen. Dies war bis dahin nur den adeligen Kreisen vorbehalten. Die Wahl des Stechhelms ist als Hinweis der verleihenden Obrigkeit zu verstehen. Dem Steinmetzstand war es auch erlaubt, ein Schwert zu tragen – ein besonderes Privileg in der damaligen Zeit.
Der Kreis
Der Kreis ist als Ausdruck der Vollkommenheit und damit des Göttlichen zu verstehen. Die vier Zirkel, als weltliches Symbol, ragen mit je einem Schenkel in den Kreis und haben so Verbindung zu Gott.
Vier Zirkel
Der Zirkel ist der Ausdruck der Kunst. In einer Zeit, zu der Messen und Konstruieren zur Einheit verschmolzen, war der Zirkel das universelle Werkzeug. Er wurde in Ehren gehalten und nicht, wie anderes Werkzeug, an Kollegen ausgeliehen.
Die vier Zirkel sind Symbol für die Vier Gekrönten mit Namen Claudius, Nicostratus, Symphorianus und Castorius. Diese Märtyrer lebten zur Zeit des Diokletian (245 – 313) und waren vier Steinmetze aus Pannonien, einer römischen Donauprovinz und vornehmlich mit Bildhauerarbeiten beschäftigt. In diesen Zeiten der Christenverfolgung wurden sie verdächtigt, Christen zu sein. Sie wurden vor das Götterstandbild des Sol geführt, weigerten sich aber, selbiges zu verehren und wurden in den Kerker geworfen, wo sie mit Skorpionen gezüchtigt wurden. Als sie trotzdem bei Ihrem Glauben blieben, wurden sie lebendig zwischen 2 Bleiplatten geschnürt und in das Wasser geworfen. Nach 40 Tagen (eben am 8. November an dem man ihrer gedenkt) wurden sie geborgen, nach Rom überführt und dort vom heiligen Sebastian beisetzen. Papst Leo IV. ließ ihre Reliquien neben der vom heiligen Sebastian in einer nach ihnen benannten Kirche der Nonnen des Conservatoriums der Waisenmädchen beisetzen, wo sie noch heute ruhen.